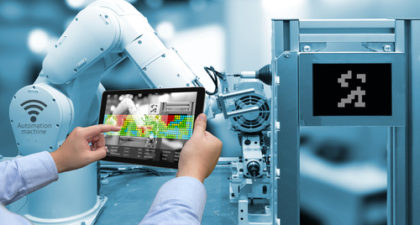
Wie Wandel gestaltet werden kann
Allein dieses Fachvokabular: Cyber-physische Systeme, Augmented Reality, Internet der Dinge; allein diese technischen Möglichkeiten: Maschinen, die vernetzt sind, Roboter, die Hand in Hand mit Menschen arbeiten, Algorithmen, die die Büroarbeit revolutionieren. Dazu die steigende Zahl von Studien: jede Woche eine neue, die einem um die Ohren flattert, mit immer neuen Zahlen, Prognosen, Befürchtungen, Erklärungen – es ist ganz schön viel.
„Es ist alles schön und gut“, sagt Markus Schaubel, ein ruhiger, besonnener Mann, 54 Jahre alt, seit vier Jahren Betriebsratsvorsitzender bei Kolbenschmidt in Neckarsulm, seit 20 Jahren Betriebsrat, seit 1979 im Unternehmen, ein Mann, der viel gehört und viel gesehen hat. „Man darf das Wichtigste nicht außer Acht lassen“, sagt Markus Schaubel.
 Das Wichtigste?
Das Wichtigste?
Was ist das?
Das ist ganz einfach, sagt Markus Schaubel. „Am Ende entscheidet sich auf dem Hallenboden, in jedem einzelnen Betrieb, an jedem einzelnen Arbeitsplatz und bei jedem einzelnen Beschäftigten, ob Digitalisierung ein Erfolg wird. Etwas, das sich gut gestalten lässt. Oder ob sie zerstörerisch wirkt.“ Um sie aber überhaupt gestalten zu können, müssten vorher ein paar elementare Fragen beantwortet werden. Zum Beispiel: Welche Arbeitsplätze in welchen Abteilungen werden durch digitale Technik bedroht? Wie verändern sich welche Tätigkeiten? Welche Qualifikationen braucht welcher Beschäftigte? Schließlich: Wie kann sichergestellt werden, dass der Beschäftigte die Qualifikation erhält?
„Genau das waren die Fragen, mit denen wir in das Projekt ‚Arbeit+Innovation‘ gegangen sind“, sagt Markus Schaubel. „Unser Ziel als Betriebsrat ist es, ein in sich stimmiges Qualifizierungssystem zu entwickeln, um auf die bevorstehenden Veränderungen reagieren zu können.“
Vor einem Jahr haben sie sich auf den Weg gemacht, noch sind sie nicht am Ziel, aber sie haben bereits ein gutes Stück geschafft. Das ist wichtig – denn dass die Veränderungen kommen werden und dass sie groß sein werden, das zeigt sich immer deutlicher.
Rund 900 Menschen arbeiten bei Kolbenschmidt in Neckarsulm, die Beschäftigten stellen hier Klein- und Großkolben für große Automobilhersteller und für Werften her. Etwa ein Drittel der Kolleginnen und Kollegen arbeitet in der Produktion, der Rest ist in klassischen Angestelltenbereichen beschäftigt, vor allem in Forschung und Entwicklung. „Mit dem Strukturwandel, in dem die gesamte Automobilindustrie derzeit steckt, haben auch wir zu kämpfen“, sagt Markus Schaubel. Vernetze Fahrzeuge, automatisiertes Fahren, natürlich die Diskussion um den Elektroantrieb – alles Faktoren, die die Arbeit in Neckarsulm wandeln.